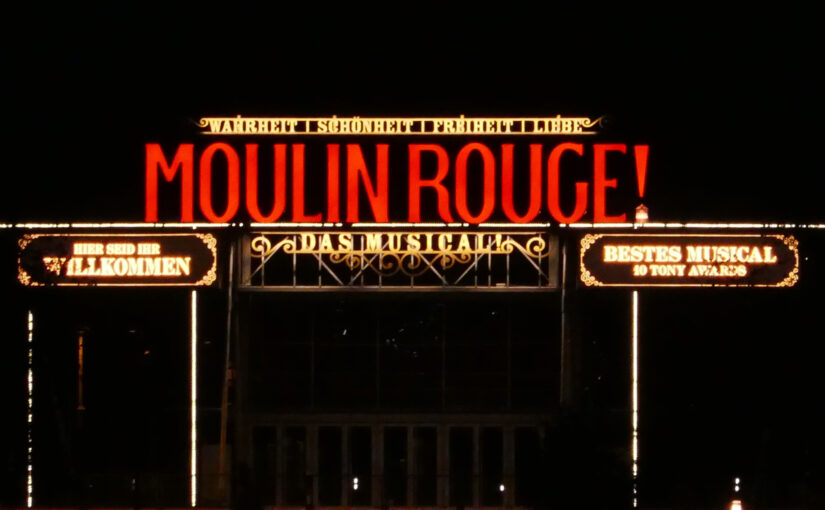Der Musical Dome in Köln, von Einheimischen wegen des blauen Dachs aus Kunststoffplane oft auch als „die Mülltüte“ bezeichnet, beherbergt seit Oktober ein neues Musical. Dieses soll anders als frühere Musicals am gleichen Ort über einen langen Zeitraum, mehrere Jahre gespielt werden. Entsprechend hat man nun das Foyer saniert und den Zuschauerraum aufwendig neu gestaltet. Und in der Tat besticht insbesondere der Zuschauerraum mit seiner vielfältigen, prunkvoll-plüschig und bestem Sinne kitschigen Dekoration. Auch das Bühnenbild und die Kulissen sind überaus gelungen. Die Kostüme fügen sich ebenfalls in das Gesamtkonzept mit ihren farbenprächtigen Designs perfekt ein.

Dennoch vermag das Musical unter dem Strich nicht überzeugen. Am Ende kommt es auf die Musik und das Schauspiel an. Und hier schwächelt es erheblich. Die gesangliche Leistung des Hauptdarstellers Riccardo Greco kann trotz der gelegentlichen Intonationsprobleme als überzeugend bezeichnet werden. Die Rolle des Christian ist wegen der in Stil und Stimmumfang schnell wechselnden Stücken sehr herausfordernd. Von satter Baritonlage bis zum Falset bedarf es eines sicheren Stimmumfangs. Die schauspielerische Leistung fällt hier jedoch ab. Die Figur wirkt nur selten überzeugend. Die Sprechanteile erinnern in ihrer Darbietung allzu oft an schlechte Vorabendserien. Greco legt die Figur tendenziell komödiantisch an. Der Entwicklung tiefen Mitgefühls des Zuschauers ist dies nicht förderlich.
Der Hauptdarstellerin Sophie Berner nimmt man die Figur der Satine nicht ab, es fehlt an der spezifischen Aura. Da nützt auch die sichere Stimmführung nicht. Andere Darstellerinnen (z. B. Annakathrin Naderer als Nini) sind da schon überzeugender. Auch Alvin Le-Bass vermag als Toulouse-Lautrec die Sympathien zu gewinnen.
Die eigentliche Schwäche des Musicals ist aber die Gesamtkonzeption aus Musik und Text. Die Dialoge werden nicht nur hölzern vorgetragen, sondern sind auch zumeist hölzern geschrieben. Die Sprache fließt nicht, was nicht nur den Darstellern, sondern auch den Autoren anzulasten ist. Die Übersetzung englischer Songs wirkt oft gekünstelt, gelegentlich auch nicht dem Versmaß bzw. dem Rhythmus folgend. Man scheint versucht zu haben, möglichst viele Stücke aus dem Bereich der wohl bekannten englischen Popsongs bis hin zum aktuellen deutschen Schlager zu verwenden. Wenn sich die Veranstalter rühmen, mehr als 150 Songrechte gesichert zu haben, kann dies leider nur als sportliche Leistung gelobt werden. Statt der Geschichte und den Emotionen zu folgen, wird so das „Erkennen Sie die Melodie“ zum Sport. Der Erzählfluss wird schlicht zerstört durch eine zu große Anzahl von Stücken, die oft nur in Fragmenten erklingen. Auch im gleichnamigen Film wird gelegentlich davon Gebrauch gemacht, dass Textzeilen einzelner Lieder sich zu einem Dialog zusammenfügen, doch steht dies anders als im Musical in einem angemessenem Verhältnis zur vollständigen bzw. weitgehenden Darbietung eines Songs. Im Musical ist das Verhältnis umgekehrt, fast kein Stück erklingt annähernd vollständig. Vielmehr erfolgen rasante Wechsel der Stückfragmente. Damit wird etwaig aufkommenden Emotionen komplett der Raum genommen. Emotionen brauchen Zeit, die nur allzu selten gegeben wird. So sind die stärksten Momente des Musicals tatsächlich die ruhigeren Passagen. Natürlich bedarf die Geschichte einer grellen, bunten und abwechslungsreicher Untermalung, auch in der Choreographie. Diese ist zwar oft schön anzusehen, doch auf die Dauer ist Vollgas eben auch ermüdend und langweilig. Dies umso mehr, wenn gerade in den Momenten, wo Empathie und Einfühlung mit den Figuren entstehen könnte, dies durch einen raschen Tempowechsel abgebrochen und so verhindert wird. Doch wenn Emotionen nicht der notwendige Raum gegeben wird, bleibt es oberflächlich. Die Geschichte rührt nicht mehr an. Weniger Songs, weniger Choreographie wäre da mehr gewesen.
Stattdessen versucht man mit übertrieben wummernden Bässen und Lautheit mitzureißen. Das wirkt jedoch nur billig. Im Übrigen wird die Lautstärke des öfteren wörtlich bis an die Schmerzgrenze ausgereizt. Da hilft dann Ohrenzuhalten.
Natürlich darf man ein Live-Musical nicht mit einem Film vergleichen. Dennoch sei erwähnt, dass eines der musikalisch interessantesten Stücke („Roxanne“) in einem Schlüsselmoment der Handlung leider weit von der Qualität des „Originals“, sprich der Bearbeitung für den Film, entfernt ist. Die spannende Polyphonie, die Ausdruck der verschiedenen Emotionen und Figuren ist, kommt leider nicht rüber. Auch szenisch gelingt die Umsetzung nicht wirklich.
Schade ist auch, dass man dem Publikum wohl wahre Begeisterung nicht zutraut. Die Zuschauer werden im Schlussfeuerwerk undifferenziert angeheizt. Eine nuancierte Rückmeldung an die einzelnen Darsteller durch stärkeren oder weniger starken Applaus ist so nicht möglich, bedauerlich.
Mängel sind auch im Vorderhaus festzustellen. Wie schon zu Zeiten der Nutzung des Zeltes als Ersatzspielstätte für die Oper Köln bleibt die Garderobensituation chaotisch. Gerade beim Abholen der Jacken fehlt ein System, aber auch Platz. Abholende drängen sich gegen diejenigen, die ihre Jacken schon in den Händen halten. Vermeidbar wäre aber sicherlich der unbefriedigende Service an den Bars. Das Personal scheint schlecht eingearbeitet. Während eine Person die Bestellung aufnimmt und kassiert und das Getränk holt oder zubereitet und ausgibt, steht ein paar Meter weiter ein Mitarbeiter herum, nur um darauf zu warten, bis der Ofen einen Flammkuchen erwärmt hat. Mit geschickterer Arbeitsteilung wäre der Service bei gleicher Personaldecke schneller und effektiver zu gestalten. Becher gibt es übrigens nur gegen Pfand, das man sich in der gleichen Schlange (also wieder langes Warten) zurückholen muss.
Auch wenn die Einrücke einer Voraufführung kurz vor der Premiere entstammen, erscheinen die Schwächen des Konzepts so zentral, dass nicht darauf zu hoffen ist, dass diese ausgeräumt werden können. Als Wirtschaftsfaktor für den Standort Köln erwarte ich zwar vom Kölner Stadtanzeiger Lobeshymnen. Doch mein Rat ist, das Geld für die musicaltypischen hohen Eintrittspreise lieber anders auszugeben, z. B. auf der anderen Rheinseite.